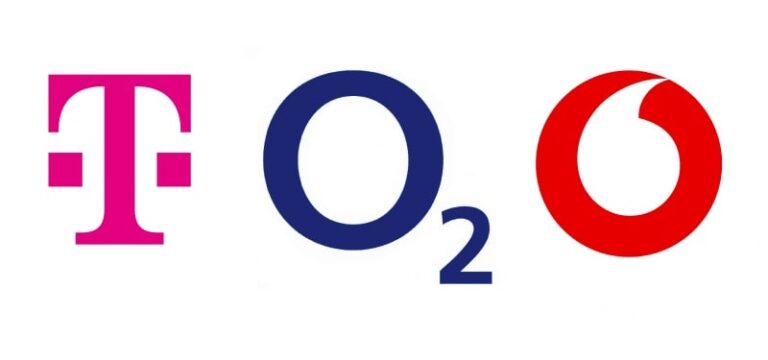Gleiches Geld für Frauenfußball? Die unbequeme Wahrheit!

Anzeige
In den letzten Jahren ist die Debatte um die finanzielle Unterstützung des Frauenfußballs immer lauter geworden. Spielerinnen fordern bessere Bezahlung, professionellere Strukturen, eine gerechtere Verteilung der Gelder innerhalb des Fußballsports, sowie deutlich mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung für den Frauenfußball. Diese, ihrer Meinung, nach gerechten Forderungen orientieren sich am Männerfußball. Doch ist diese Forderung wirklich gerechtfertigt, oder handelt es sich um eine fragwürdige Umverteilung, die auf Kosten des etablierten Männerfußballs geht?
Frauenfußball: Zwischen Wunschdenken und Wirklichkeit
Kritiker dieser Umverteilungsträume im Frauenfußball argumentieren, dass viele andere Sportarten, darunter auch zahlreiche Männersportarten, finanziell schlechter dastehen als der Frauenfußball. Beispielsweise haben Randsportarten oft gar keine Möglichkeit, sich Medial lautstark in Szene zu setzen und finanzielle Vorteile herbeizuklagen. Ihnen fehlt die entsprechende Lobby und die mediale Aufmerksamkeit, die eingeschränkte sportliche Reichweite tut ihr übriges.
Die Strategie hinter dem Druck auf die Männervereine
Eine gängige Taktik zur finanziellen Verbesserung des Frauenfußballs ist es, konstant Druck auf männlich dominierte Fußballstrukturen auszuüben. Medien und feministische Bewegungen fordern eine Umverteilung der Millionen, die im Männerfußball erwirtschaftet werden, hin zum Frauenfußball. Das Ziel scheint klar: Die Vereine und Vorstände müssen so lange unter Druck gesetzt werden, bis sie nachgeben und die Budgets für die Frauenabteilungen erhöhen.
Die Rolle der Unabhängigkeit im Frauenfußball
Während Forderungen nach Equal Pay und mehr finanzieller Gleichstellung im Frauenfußball immer lauter werden, zeigt der aktuelle Trend ein anderes Bild. Statt eigenständig und nachhaltig zu wachsen, suchen viele Frauenfußballvereine Schutz bei etablierten Männerclubs. Dies stellt die viel propagierte Unabhängigkeit der Frauen infrage: Geht es tatsächlich um Gleichberechtigung oder eher um finanzielle Sicherheit?
Alle großen Fußballvereine haben mittlerweile eigene Frauenabteilungen gegründet, um den Frauenfußball als Sport zu integrieren. Unabhängige Frauenfußballvereine gibt es nur wenige und wenn, dann kämpfen sie alle ums überleben.
Ein prominentes Beispiel ist der 1. FFC Turbine Potsdam. Einst eine der erfolgreichsten Frauen-Mannschaften im deutschen und europäischen Frauenfußball, kämpft der Verein heute nicht nur gegen den sportlichen Abstieg aus der Frauen-Bundesliga, sondern auch gegen eine drohende Insolvenz. Eine mögliche Verschmelzung wäre mit Hertha BSC oder 1. FC Union Berlin denkbar.
Anzeige
Ein weiterer renommierter Frauenfußballverein hat sich bereits in die finanzielle Sicherheit eines Männerclubs gerettet: Der 1. FFC Frankfurt schließt sich Eintracht Frankfurt an. Diese Entscheidung kommt auch nicht von ungefähr. Die sportlichen Aussichten des FFC Frankfurt wären nicht von Erfolg gekrönt gewesen und ohne gesicherte finanzielle sowie infrastrukturelle Unterstützung wäre eine eigenständige Zukunft kaum möglich gewesen.
Diese Entwicklung im Frauenfußball wirft eine zentrale Frage auf: Bedeutet die Eingliederung der Frauenfußballvereine in Männerclubs die vielbeschworene Unabhängigkeit der Frauen und damit einen echten Fortschritt für den Frauenfußball oder begibt man sich aus Bequemlichkeit in die finanzielle Hängematte des Männerfußballs?
Die Realität zeigt ein eindeutiges Bild: Die finanzielle Basis des Frauenfußballs bleibt weiterhin unsicher, während die Unterstützung durch Männervereine zur Überlebensstrategie wird. Es ist eine Bankrotterklärung für den unabhängigen Frauenfußball und diesem Trend stehen ungerechtfertigte Forderungen nach Equal Pay durch prominente Vertreterinnen wie Nadine Angerer, Almuth Schult und Giulia Gwinn entgegen. Eine bessere Bezahlung, finanzielle Gleichstellung und mehr Anerkennung sind unter allen ökonomischen Gesichtspunkten völlig geistesabwesende Forderungen für den Frauenfußball.
Anstatt sich eigenständig und nachhaltig in kleinen Schritten zu entwickeln, will man das große ganze und sucht lieber den Schutz großer Männervereine. Dies wirft ein negatives Licht auf das vermeintliche Streben nach Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Es geht nicht um Gleichberechtigung sondern eher um den einfachen Weg der finanziellen Sicherheit!
Frauenfußball im Vergleich: ein Blick auf die Realitäten
Es ist unbestreitbar, dass Frauen im Fußball oft schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Die Gründe dafür sind jedoch vielschichtig und nicht allein auf eine vermeintliche Ungerechtigkeit zurückzuführen. Da können bekannte Fußballerinnen wie Almuth Schulte noch so lautstark in TV-Interviews jammern. Diese sozialistischen Forderungen der Frauen sind völlig haltlos und ihnen steht kein Mehrwert gegenüber. Die wichtigsten Faktoren im Fußball sind unter anderem:
- Wirtschaftliche Faktoren: Der Männerfußball generiert durch Sponsoring, Ticketverkäufe und TV-Rechte Milliardenbeträge. Der Frauenfußball kann bisher nicht annähernd solche Einnahmen vorweisen.
- Publikumsinteresse: Während Männerfußball weltweit Millionen Fans mobilisiert, sind die Zuschauerzahlen im Frauenfußball trotz Wachstum weiterhin vergleichsweise sehr gering.
- Geschichtlicher Kontext: Der Männerfußball hat eine lange Tradition und war stets ein kommerzielles Zugpferd. Frauenfußball hingegen war lange Zeit marginalisiert und befindet sich erst seit wenigen Jahrzehnten im professionellen Aufbau.
Anzeige
Vergleich von Frauen- und Männerfußball: Bezahlung, Prämien, Transfergelder und Zuschauerzahlen
Der Vergleich zwischen Frauen- und Männerfußball sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Während Frauen zunehmend höhere Gehalts- und Prämienforderungen stellen, argumentieren Kritiker, dass die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen beiden Bereichen eine solch direkte Gleichstellung nicht rechtfertigen. Hier ein detaillierter Vergleich der wichtigsten Faktoren:
Zuschauerzahlen und TV-Rechte
- Männerfußball: Die Bundesliga verzeichnet durchschnittlich rund 43.000 Zuschauer pro Spiel. Bei internationalen Top-Spielen liegt diese Zahl oft bei über 60.000. Die Werte bleiben konstant auf sehr hohem Niveau, auch im Vergleich zu anderen Ligen weltweit.
- Frauenfußball: Die Frauen-Bundesliga erreicht durchschnittlich 1.000 bis 3.000 Zuschauer pro Spiel, wobei Spitzenspiele bis zu 30.000 Fans anlocken können. Die Zuschauerzahlen halten sich in Deutschland im weltweiten Vergleich auf einem niedrigen Niveau. Daran hat sich in den letzten Jahren, auch durch extreme Werbekampagnen für die Frauen-EM und Frauen-WM, nur wenig verändert.
- TV-Rechte: Die Bundesliga erzielte 2021-2025 TV-Rechte-Einnahmen von etwa 1,1 Milliarden Euro pro Saison. Im Gegensatz dazu liegt der TV-Vertrag für die Frauen-Bundesliga bei geschätzten 5-10 Millionen Euro pro Saison.
Einnahmen und Ausgaben der Fußballvereine
- Männerfußball: Die großen Vereine wie Real Madrid oder Bayern München erzielen jährliche Umsätze von über 700 Millionen Euro. Einnahmen aus Sponsoring, Ticketverkäufen und Merchandising tragen erheblich dazu bei. Viele Vereine leben über ihren Verhältnissen. Bayern München ist ein vorbildliches Beispiel im haushalten seiner Finanzen.
- Frauenfußball: Frauenmannschaften generieren deutlich weniger Einnahmen als ihre männlichen Kollegen. Selbst Top-Clubs im Frauenfußball erwirtschaften selten mehr als 10 Millionen Euro pro Jahr. Die Frauenfußball Vereine erwirtschaften immer noch ein Minus trotz steigender Umsätze durch Sponsoren- und TV-Einnahmen.
Quersubventionierung: Die Vereine, die auch in der Fußball Bundesliga der Männer vertreten sind, gleichen das Minus der Frauenabteilung aus und investieren in den Frauenfußball. Es findet eine Quersubventionierung des Frauenfußballs durch den Männerfußball statt. Laut DFB-Prognosen soll ab der Saison 2026/27 keine Quersubventionierung mehr durch den Männerfußball erfolgen. Bis dahin bleibt der Frauenfußball ein Zuschussgeschäft!
Anzeige
Bezahlung der Spieler und Spielerinnen
- Männerfußball: Die Topstars im Männerfußball verdienen jährlich mehrere Millionen Euro. Beispielsweise erhält Lionel Messi (Inter Miami) ein geschätztes Jahresgehalt von über 45 Millionen Euro, während viele Bundesliga-Spieler jährlich zwischen 1 und 10 Millionen Euro verdienen.
- Frauenfußball: Die Bezahlung fällt im Frauenfußball deutlich geringer aus. Alexia Putellas (FC Barcelona) als eine der bestbezahlten Spielerinnen der Welt verdient etwa 500.000 Euro jährlich. Durchschnittliche Spielerinnen in der Frauen-Bundesliga verdienen oft weniger als 50.000 Euro pro Jahr.
Siegprämien und Turnierboni
- Männer-WM 2022: Das Siegerteam (Argentinien) erhielt 42 Millionen US-Dollar an Prämien. Insgesamt betrug der Preisgeldtopf 440 Millionen US-Dollar.
- Frauen-WM 2023: Die Siegerinnen (Spanien) erhielten 10,5 Millionen US-Dollar. Der Gesamtpreisgeldtopf lag bei 110 Millionen US-Dollar. Ein erheblicher Anstieg gegenüber früheren Turnieren, jedoch noch weit von den Männern entfernt.
Transfergelder
- Männerfußball: Transferrekorde im Männerfußball bewegen sich in astronomischen Höhen. Neymar wechselte 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu Paris Saint-Germain. Selbst durchschnittliche Bundesliga-Spieler erzielen Transfererlöse im zweistelligen Millionenbereich.
- Frauenfußball: Der bisher teuerste Transfer im Frauenfußball war der Wechsel von Naomi Girma vom San Diego Wave zu FC Chelsea für etwas nehr als eine Million Euro – ein Bruchteil der Summen im Männerfußball gezahlt werden.
Anzeige
Frauenfußball als neues Spekulationsobjekt: Vereine und Investoren setzen auf steigende Transferwerte
Der Frauenfußball hat sich weltweit zu einem neuen Spekulationsobjekt entwickelt, da der Männerfußball zunehmend gesättigt ist, der Transfermarkt völlig überhitzt und die Spielertransfers immer unrealistische Höhen erreichen. Mit astronomischen Summen für Spieler, die oft den wirtschaftlichen Rahmen sprengen, suchen Fußballvereine nun nach neuen Möglichkeiten, ihr Kapital gewinnbringend anzulegen. Der Frauenfußball bietet dabei ein ideales Betätigungsfeld: Die noch vergleichsweise niedrigen Transferkosten im Vergleich zum Männerfußball machen ihn zu einem lukrativen Markt, in dem Vereine und Investoren Potenzial für hohe Renditen sehen.
Der Aufstieg des Frauenfußballs durch den gesteigerten Fokus der großen Traditionsvereine weltweit wie bei Madrid CFF (Real Madrid), FC Barcelona, Manchester City, FC Chelsea und auch Bayern München, sowie das wachsende Interesse von Sponsoren und Medien schaffen ein Umfeld, in dem sich Investitionen in Frauenfußball-Vereine und Spielerinnen auszahlen könnten.
Spielerinnen wie Naomi Girmah, deren Transfer von San Diego Wave zu FC Chelsea für rund 1 Million Euro als der höchsten im Frauenfußball gilt, sind daher unter anderem auch von wirtschaftlichem Interesse geprägt. Auffällig ist, das immer wieder die gleichen Vereine auf der Transferliste mit den höchsten Spielertransfers auftauchen. Das sind nämlich die Vereine, die schon im Männerfußball für die höchsten Ablösesummen verantwortlich sind.
Höchste Ablösesummen: Die teuersten Spielerinnen im Frauenfußball
Hier werden immer mehr Gewinne erwirtschaftet, während sich der Männerfußball zunehmend in einer Spirale von immer höheren, aber auch zunehmend unrealistischeren Transfers befindet. In diesem Spannungsfeld wird der Frauenfußball nicht nur als sportliche, sondern auch als wirtschaftliche Wachstumschance betrachtet.
Fazit: undankbare Forderungen im Frauenfußball
Der finanzielle Unterschied zwischen Männer- und Frauenfußball basiert in erster Linie auf den generierten Einnahmen durch die Nachfrage seitens der Zuschauer und Sponsoren. Während Frauenfußball wächst und immer populärer wird, ist es illusorisch zu glauben, er könne in Zukunft wirtschaftlich mit dem Männerfußball konkurrieren. Forderungen nach gleicher Bezahlung müssen sich langfristig an den realen Marktbedingungen orientieren und die ist mit den Subventionierungen durch den Männerfußball schon längst überschritten.
Die Forderung nach mehr Geld im Frauenfußball sind extrem unverschämt. Einerseits ist es nachvollziehbar, dass Spielerinnen bessere Bedingungen und mehr Geld verdienen wollen. Andererseits muss sich der Frauenfußball wirtschaftlich selbst behaupten und darf nicht nur von politischen oder medialen Kampagnen getragen werden. Selbstständige und nachhaltige Entwicklung sollte Vorrang vor forcierten Umverteilungen haben. Die Forderungen nach mehr Geld ist eine lautstark geforderte Umverteilung auf Kosten des etablierten Männerfußballs!
Wenn Frauenfußball nur auf Pump existieren kann, dann liegt es auch daran das die Spielerinnen bereits jetzt schon zu hohe Gehälter bekommen und der Frauenfußball als Geschäftsmodell nicht rentabel ist.
Anzeige